“Tja, Frau Vorbach, da haben Sie jetzt die Chaoten-Therapeutin abbekommen. Müssen Sie jetzt mit leben.”
– Meine Bezugstherapeutin, gleich in der ersten Sitzung
In diesem Post geht es weiter mit meinen Erfahrungen aus dem Aufenthalt in der Schön Klinik Bad Bramstedt. Ich erzähle euch, wie meine Freizeit aussah, wie sich der “Schutzraum Klinik” für mich anfühlte und wie es dann wieder zurückging, in die beängstigende, normale, fremd gewordene Alltagswelt. Zum ersten Teil kommt ihr hier.
Der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen
Obwohl die Schön Klinik eine psychosomatische Klinik ist (oder gerade deshalb) hatte ich in meiner Freizeit sehr viel Spaß. Die Schamgrenze ist einfach eine andere, wenn man in der Therapie mit leeren Stühlen redet oder Briefe an einen längst verdrängten Teil seiner selbst schreibt (Stichpunkt Schematherapie). Zum Beispiel sammelte ich eines Abends mit einer Mitpatientin zusammen alle “Anti-Stress-Knet-Bälle” ein und warf diese einfach 15 Minuten gegen eine Wand des Aufenthaltsraumes. Das war laut. Aber irgendwie schien das auch niemanden zu stören, und der Raum war voll.
Ein anderer Mitpatient hat kurzerhand sein Zimmer bunt gestrichen. Ein richtiges Mosaik hat er dort gezaubert- natürlich war das verboten. Ist ja schließlich ein Krankenhaus. Ein paar Tage später hat er es einfach wieder weiß übergestrichen.
Alle paar Tage waren die Bilder auf unserer Station (die alle irgendwelche Naturlandschaften auf Leinwand waren), mal wieder um 180° gedreht. Und dann gab es massenhaft erwachsene Menschen, die mit Plüschtieren oder auch “Kinderspielzeug” unterwegs waren.
Mein persönliches Highlight war ja “Die Kuh mit Hut”. Ungefähr 2 Wochen vor meiner Entlassung fand ich bei einem Spaziergang mit zwei Mitpatientinnen eine Kuhweide. Wunderbarerweise ließen sich diese Kühe (ich glaube, in Wahrheit waren es Rinder…?) mit Äpfeln anlocken, füttern und streicheln. An diesem Tag trug ich einen Hut, und ja. Ich fand es einfach lustig, der Kuh meinen Hut aufzusetzen – Es war mir egal, ob sie damit wegläuft, irgendwie… aus dem Moment heraus fand ich es einfach richtig, das zu tun.
Und das ist auch wieder etwas, was ich in der Klinikzeit wieder mehr gemacht habe. Einfach mal mehr aus einem Gefühl heraus zu tun. Einfach Quatsch machen, wenn mir danach ist. Einfach mal aufatmen, Konsequenzen Konsequenzen sein zu lassen und nur durch einen Brunnen zu laufen, weil es Spaß macht. Meinen Hut habe ich tatsächlich auch wieder bekommen. Die Kuh war einfach zu Apfel-interessiert 🙂

Mit dem herbstlichen Wetterumschwung wurden dann auch die Indoor- Aktivitäten spannender. Durch Corona waren die aber leider auf den Aufenthaltsraum und das Klinikgelände beschränkt. Da gab es die im ersten Teil erwähnte Klapsen- Olympiade: Puzzlen, Diamond Painting, Wikinger- Schach (das war natürlich draußen und viel langweiliger, als es klingt) . Außerdem waren einige Leute von der F2 mit Campern oder großen Autos angereist, neben denen man wunderbar grillen und Musik hören konnte. So habe ich mich zum Beispiel von Vivien, einer Freundin, die vor mir entlassen wurde, verabschiedet. Es waren sehr schöne Momente dabei in diesen 11 Wochen.
Wie hat sich der Schutzraum Klinik angefühlt?
Ihr habt bestimmt schonmal gehört, dass Menschen eine psychosomatische Klinik oder eine Psychiatrie als Käseglocke oder Blase beschreiben. Ein bisschen so war es auch. Ich glaube, ich war nie an einem Ort, an dem ich mich “verstandener”, “unterstützter” oder auch “geborgen” gefühlt habe. Ich musste hier nichts verstecken, habe mich aber auch angreifbar gemacht. Mich zu öffnen war nicht leicht, erst gegenüber Vivien und ausgewählten “Klinik-Bekanntschaften”, dann den TherapeutInnen und ÄrtztInnen gegenüber, und am Ende auch in den Gruppentherapien. Ich wurde an die Grenze meiner Belastung geführt, indem ich vor meinen inneren Mauern stand, nicht weiterkam und dann doch über Gefühlsprotokolle “Schlupflöcher” zu alten Erinnerungen fand, die ich mit aller Kraft zu verdrängen versucht hatte. An einigen Tagen ging es mir damit sehr schlecht, ich war ständig am Skillen, mit Wiedererlebens-Momenten und Gefühlsextremen konfrontiert.
Trotzdem, meine Bezugstherapeutin hat mir das Gefühl gegeben, auf mich aufzupassen. Sie sagte: “Ihr Körper lässt Sie nichts fühlen, was er nicht aushalten könnte” und: “Egal, was hier passiert, ich krieg Sie schon irgendwie wieder auf Ihr Zimmer.” Das hat mir Sicherheit gegeben und langsam konnte ich lernen, dass alte Erinnerungen, schlimme Erfahrungen und ignorierte Teile meiner Persönlichkeit vielleicht doch ihren Platz brauchen in meiner Lebensrealität.
Außerdem gab es diese Erleichterung, als ich die Diagnose “emotional instabile Persönlichkeitsstörung” bekommen habe: Ich habe all die Jahre gegen Verhaltensmuster gekämpft, die mich irgendwann mal geschützt haben. Ich habe quasi gegen mich selbst gekämpft. Gegen Mechanismen, die mir lebensrettend erschienen. Ich konnte gar nicht immer gewinnen. Und ein klein wenig konnte ich mir damit verzeihen. Das, was ich als Schwäche ansehe, einfach als “logisch” zu betrachten.
Das klingt ja alles erstmal toll. Verantwortung abgeben können, mich um nichts kümmern zu müssen als um meine Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse. Unterstützung zu bekommen, wann immer ich sie brauche.
Das Problem ist nur, dass ich mich in diesen 11 Wochen auch ein wenig an die “Patientinnenrolle” gewöhnt habe. Ich habe ein wenig den Bezug zu dem verloren, was ich alles KANN. Ich habe so viel Zeit mit meinem inneren Chaos und meinen Erkrankungen verbracht, dass ich mich als gesamte Person ein bisschen aus den Augen verloren habe.

Meine letzte Einzeltherapie-Stunde
Im Großen und Ganzen wurde ich dazu motiviert, dranzubleiben. Sie hat mir ein bisschen vorgehalten, was ich alles geschafft haben, mich gelobt á la “Das schaffen nicht alle in einem Aufenthalt”, mir gesagt “Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Gefühlsebene erreicht”. Sie hat in mein Buch geschrieben, hat meinen Brief gelesen, und sich dann sehr über diesen Ball gefreut. Schokolade schien nebensächlich. Sie sagte: “Oh da freut sich die kleine Frau W. jetzt aber sehr drüber. Hatte ganz vergessen, dass ich so einen wollte.” – wohl um mir nochmal zu signalisieren, dass es okay ist, Klein-Anna Beachtung zu schenken. Erstmal den Ball an die Wand werfen.
“Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Der kommt nie wieder runter.”
“Hmm. Ich denke grad den Flur nach langen Kollegen durch, die mir den von der Decke holen können.”
“Dann müssen Sie das aber erklären.”
“Ach was, ich sag einfach, das war meine Patientin.”
“Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, ich verstecke mich beim letzten Einzel hinter diesem Stuhl hier und weigere mich, zu gehen.”
“Und jetzt?”
“Glaube ich, ich schaffe es tatsächlich, gleich durch diese Tür hier zu gehen. Das hatte ich nicht erwartet.”
Mein Blick schweift nach oben, zu diesem Ball, der da klebt, als würde er nie, nie wieder da runter kommen. Ihr Blick geht auch nach oben.
Beide gucken wir uns diesen Ball an. Belustigt.
Die Angst ist da. Aber wir müssen wohl einfach schauen, was die Zeit so mit sich bringt.
Ich konnte diesen Raum verlassen, auch darum, weil mir in den letzten Tagen so oft versichert wurde, dass ich wiederkommen könne. Und auch darum, weil mir diese 11 Wochen gezeigt haben, dass ich eine gewissen Selbstwirksamkeit entwickelt habe. Dass ich selbst etwas an meiner Lage ändern kann. Und jetzt heißt es üben. Üben. Üben. Üben. Und dranbleiben. Danke, Frau W.
wie waren die ersten Wochen nach der klinik?
Um ehrlich zu sein, waren die ersten Wochen zuhause ziemlicher Horror. Da vertraut man sich einer Person an, hat eine Bezugsperson, die man im Extremfall jeden Tag ansprechen kann, die einem Halt gibt, und der man vertraut… und dann. Ist diese Person von einem auf den anderen Tag… weg. Nicht mehr verfügbar. Es ist ein bisschen so, als hättet ihr eine:n gute:n Freund:in, und am nächsten Tag ruft ihr an und die Leitung sagt: “Kein Anschluss unter dieser Nummer”. Ich fühlte mich wahnsinnig angreifbar, hatte ich eine Woche zuvor noch viel zu tief in alten Gefühlen herumgegraben. Die Stadt war mir zu laut, die Menschen zu viel, die Eindrücke zu viel. Ich war schreckhaft und hatte nicht das Gefühl, je wieder so stark sein zu können wie ich es vor dem Aufenthalt war.
Ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass ich mich in der Patientinnenrolle sah und zum anderen ist Bad Bramstedt auch einfach eine Art Dorf. Zumindest im Vergleich zu Hamburg. Ich vermisste den Schutzraum, hatte Angst, jetzt auf der Stelle wieder “funktionieren” zu müssen und Ansprüchen nicht gerecht werden zu können.
Ich muss auch lernen zu akzeptieren, dass ich zwar sehr viel über mich und meine Erkrankungen gelernt habe, aber ich nicht gleich “geheilt” bin. Dass ich nicht gleich alles umsetzen kann, was ich gelernt habe. Das ich noch immer mitten auf dem Weg bin, mir ein besseres Lebensgefühl zu erkämpfen. Und dass es noch lange, lange ein Kampf bleiben wird.
Die Vorteile zuhause
In den ersten Wochen habe ich auch viele tolle Dinge geschafft und auch bemerkt, was da schon war. Zum Beispiel war meine Freundin die ersten Tage ganz für mich da. Sie ist aus Berlin angereist und hat versucht, mir mein “Ankommen” so angenehm wie möglich zu gestalten. Danke. Ich habe gemerkt, dass ich meinen Mitbewohner vermisst habe, meine Wohnung, meine eigenen 4 Wände, mein Bett, meine Kuscheltier-Herde. Und dass es schön ist, auch nach 22 Uhr rausgehen zu können, Freunde einfacher treffen zu können und zu kochen, was immer ich mag.
Auch ein ambulanter Therapieplatz ist in greifbare Nähe gerückt. Nachdem ich schon in der vierten Klinikwoche angefangen habe, Therpeut:innen anzufragen, ist es dann schließlich bei der 26. kontaktierten Person etwas geworden. Da liegt es im Endeffekt jetzt nur noch an der Krankenkasse, ob es was wird oder nicht. Vielversprechend ist das auf jeden Fall, da die Therapeutin auch nach dem DBT Konzept arbeitet.
Tipps für die klinik, die ich geben kann
Am Ende möchte ich euch noch 3 Tipps geben.
- Gebt euch Zeit, wenn ihr eine Therapie anfangt. Egal ob ambulant oder stationär, es braucht eine Weile, bis sich ein Gefühl von “Hier bin ich richtig” einstellt. Bei meiner ersten Therapeutin hat das Monate gedauert, und auch in der Klinik ca. 2 Wochen. Vielleicht setzt ihr euch eine Zeit fest, in der ihr euch nur vornehmt, es auszuprobieren. Versucht dranzubleiben, bis ihr eine fundierte Entscheidung treffen könnt, ob ihr bleibt oder es lassen wollt.
- Lasst euch ein Buch gestalten, wenn ihr die Klinik verlasst. Bei mir war das so, dass ich in der Chefarztgruppe gemerkt habe, dass mein Selbstbild ganz schön von der Wahrnehmung der Mitpatient:innen abweicht. In der Chefarztgruppe konnte jeder frei ein Thema ansprechen und dann wurde gebrainstormt. Ich habe mir ein Feedback gewünscht, um mal zu überprüfen, wie ich auf andere wirke. Und da habe ich festgestellt, dass die anderen ganz schön viel von mir hielten. Das einzige, was ich davon selbst an mir wahrnahm war “verwirrt”. Aber zurück zum Buch, als mein Entlassungstermin feststand legte ich ein leeres Buch in den Aufenthaltsraum, mit einer Notiz, die anderen könnten gerne etwas reinschreiben, damit ich etwas von ihnen mitnehmen kann. Und es war wunderbar. So viele Mitpatient:innen haben ganz tolle Dinge rein geschrieben, auch meine Therapeutin und Co-Therapeutin, und so kann ich jetzt im Nachhinein dieses Buch aufschlagen und mich erinnern, dass er mir so viele Erkenntnisse gebracht hat, mein Sommer in Bad Dachschaden. Und dass ich mehr wert bin, als ich an einigen Tagen denke.
- Und hier kommt der Tipp, den ich selbst beherzigen muss. Derjenige, der mir selbst schwer fällt. Kurz zum Hintergrund: In der Klinik habe ich viele Leute kennengelernt, die nicht zum ersten Mal dort waren. Mein Chefarzt verabschiedete mich mit den Worten: “Nun gehen Sie, leben ein bisschen mit sich selbst und wenn sie kein Bock mehr haben sich rumzuärgern, dann kommen Sie wieder”. Sowohl Co-Therapeutin als auch Arzt schienen sich einig zu sein, dass dieser erste nicht mein letzter Klinikaufenthalt sein wird. Gepaart mit dem “Schutzraum-Gefühl” ist das eine ganz schön gefährliche Mischung. Und hier kommt der Tipp an mich selbst: Ich möchte die Klinik nicht als Flucht betrachten, einfach nur, weil das Gefühl so viel Geborgenheit beinhaltete. Ich möchte die Klinik als Möglichkeit betrachten, weiter zu kommen. Aber vielleicht komme ich ja auch ambulant weiter. Ich möchte den nächsten Aufenthalt nicht planen. Ich möchte schauen, wie es läuft. Und wenn es zu sehr wieder bergab geht, ja klar. Ich werde mich nicht erst wieder jahrelang aufreiben, bis ich den Schritt wage, aber es darf einfach nicht die “einfache Lösung für alles” werden.

Fazit
Um ein kurzes Fazit zu schreiben: Ich bereue GAR NICHTS. Nicht die Entscheidung, in die Klinik gegangen zu sein, nicht die Wahl der Klinik und schon gar nicht, offen über alles zu berichten. Ich bin froh, euch allen, die ihr das hier lest einen Blick hinter meine Kulissen zu ermöglichen. Und ich bin froh, dass ihr da seid. Hiermit werde ich den Klinikbericht jetzt abschließen, aber wenn ihr Fragen habt, immer gerne. Über Instagram; über das Kontakt-Formular oder als Kommentar, ihr wisst schon.
Danke.
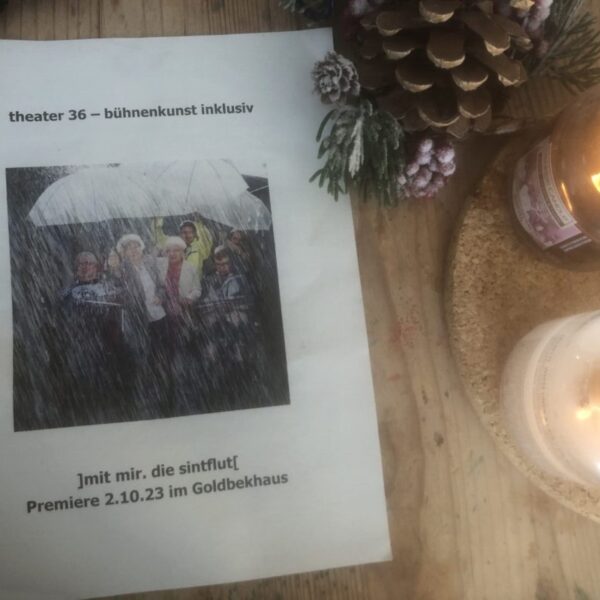





Sehr geil Anna. Ich zieh den Kuh – Hut vor dir und neige mein Haupt. 😄. So toll geschrieben… es war schon ne anstrengende,aber erkenntnisreiche Zeit in der Ballerburg🥰🥰…
Drück dich ganz lieb ( ahhhrgg…sorry…. darf ich???? 🤪)
Dein Patenkind
Du darfst. Vielen Dank, Katja. Ich bin sehr gern Patentante. Gleich mehrfach 😀
Hallo Anna,
danke, für diesen ausführlichen Bericht 🙂
Hey Martina,
danke für dein Feedback, es hat mir selbst auch sehr gut getan, diesen Bericht zu schreiben 🙂